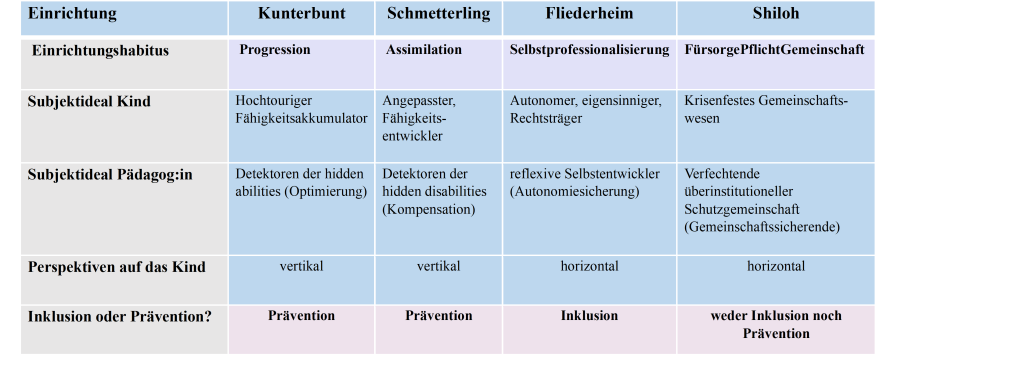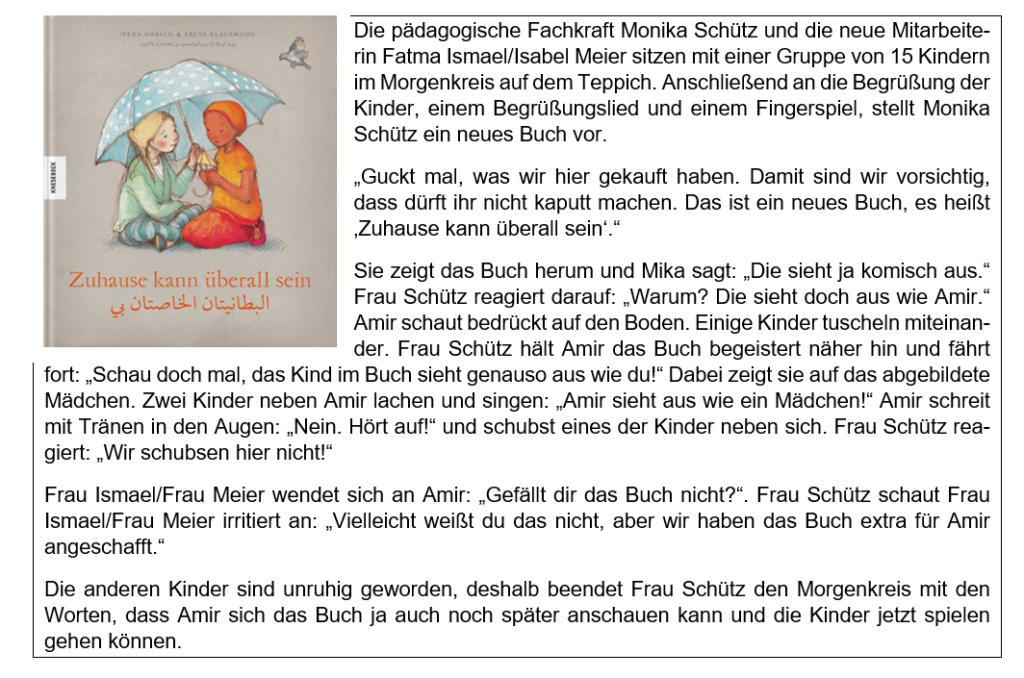| Franziska Korn & Manuela Westphal |
Familien und Kindheiten im Kontext von Flucht und Asyl sind im deutschsprachigen Raum bisher eher wenig beforscht (Korn/Westphal 2024). Zwar ist in den vergangenen Jahren eine wachsende Zahl von Studien entstanden, welche jedoch zukünftig noch weiter ausdifferenziert werden sollten. Bisher wurden beispielsweise Perspektiven geflüchteter Kinder auf das Leben in Sammelunterkünften (Wihstutz 2019; Buser 2024), das Vertrauen geflüchteter Eltern in frühpädagogische Angebote (Sandermann et al. 2023) oder die Gestaltung von Familienbildungsprogrammen (Korntheuer/Korri 2021) untersucht. Insgesamt besteht jedoch wenig Wissen darüber, wie Familien im Kontext von Flucht und Asyl ihren (transnationalen) Familienalltag gestalten und sich Familienerziehung dabei verändert. Dieser Beitrag fragt daher danach, wie familiäre Erfahrungen von Flucht und Asyl, besonders im Verhältnis zu Kitas, das Aufwachsen von Kindern beeinflussen.
Was will das Projekt? Was ist das Phänomen?
Eine Flucht, die sich nicht selten über Monate oder Jahre erstreckt, sowie die Auseinandersetzung mit Bedingungen des Asyl- und Migrationsregimes (z.B. Aufenthaltsrecht, Unterbringung, (psycho-)soziale Versorgung) stellen für individuelle sowie familiäre Biografien einen prägenden und transformativen Einschnitt dar. Im Rahmen des Projektes „Wandel und Dynamik familiärer Generationenbeziehungen im Kontext von Flucht und Asyl“[1] wird untersucht, wie Familienbeziehungen und Erziehung nach der Flucht in Deutschland (neu) ausgehandelt und organisiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass Flucht- und Asylerfahrungen auch lange nach der Flucht und intergenerational bedeutsam sein können. Beispielhaft wird dies anhand von Familien aus Somalia, die in Deutschland Schutz gefunden haben, untersucht. Für viele dieser Familien sind seit Ausbruch des Bürgerkriegs Anfang der 1990er Jahre komplexe transnationale Familienbeziehungen und Fragmentierungen konstitutiv geworden, was in der Bezeichnung als „global refugees“ (Hammond 2014, S. 13) prägnant zum Ausdruck kommt. Dies betrifft jedoch auch viele Familien aus anderen Herkunftskontexten, die Erfahrungen von Flucht und Asyl teilen.
Anknüpfend an den „Doing Family“-Ansatz (Jurczyk 2020) betrachten wir Familie als Herstellungsleistung, welche von den einzelnen Mitgliedern kontinuierlich alltagspraktisch erbracht werden muss. Im Kontext von Migration bedeutet das im Sinne eines „transnational doing family“ (Westphal/Motzek-Öz/Aden 2019) die Herstellung von Familie über Ländergrenzen hinweg. So wird Familie trotz physischer Distanz beispielsweise durch Urlaubsbesuche, Videoanrufe, dem Teilen von Fotos und Videos (im Sinne von „Displaying Family“) oder monetäre Rücküberweisungen an zurückgelassene Angehörige auf organisationaler und emotionaler Ebene aufrechterhalten, kann aber auch unter- oder abgebrochen werden (Aden/Westphal 2021). Diese transnationalen Lebenswelten finden allerdings im Rahmen institutioneller Betreuung in der frühen Bildung bisher wenig Beachtung (Korn 2023).
Wie sind wir vorgegangen?
Im Rahmen eines mehrstufigen ethnografischen Forschungsdesigns wurden schrittweise Daten mit insgesamt zehn aus Somalia nach Deutschland geflüchteten Familien erhoben. Die Familien hatten zwischen zwei und sieben Kindern, die überwiegend in Deutschland, zum Teil aber auch in Somalia oder angrenzenden ostafrikanischen Ländern lebten. Alle Familien wurden über einen Zeitraum von teilweise mehr als einem Jahr mindestens fünfmal bei sich zuhause besucht oder im Alltag begleitet (z.B. bei Abholungen aus Kita und Schule, auf dem Spielplatz oder im Café). Nach einer initialen Phase des Vertrauensaufbaus wurden zunächst Netzwerkkarten, geleitet von der Frage, wer zur Familie gehört, ko-konstruktiv mit den Familien erstellt (Westphal/Korn 2023). Dabei bestätigten sich die starken globalen Fragmentierungen und transnationalen Verflechtungen. Es wurden Familienangehörige u.a. in verschiedenen Ländern Ostafrikas, Nordamerikas und Europas aufgeführt. Anschließend stellten die Familien, geleitet von der Frage, was für sie Familie bedeutet, Fotos zur Verfügung. Schließlich wurden Interaktionen innerhalb der Familien beobachtet und teilweise videografiert. Abschließend fanden reflektierende Interviews mit einem oder beiden Elternteilen, zum Teil gedolmetscht, statt. Kinder waren im Rahmen der Datenerhebung insbesondere während der Familienbesuche sehr präsent. Die Daten werden mit der Dokumentarischen Methode ausgewertet (Interviews, Fotos, Videos) und mit ethnografischen Daten in Bezug gesetzt (Bohnsack 2018, 2021; Neumann 2019).
Was ist das Ergebnis?
Im Rahmen bisheriger Auswertungen haben wir verschiedene fallspezifische Orientierungsmuster herausgearbeitet, in denen das implizite habitualisierte Wissen und elterliche Deutungen über Familie und Familienerziehung zum Ausdruck kommen. Damit sind meist unbewusste, verinnerlichte Vorstellungen und Handlungsweisen gemeint, die so selbstverständlich sind, dass sie in der Regel nicht hinterfragt werden müssen. Diese stehen im Verhältnis zu gesellschaftlichen und institutionellen Normen, die an die Familien herangetragen werden. Wie diese Deutungen das Aufwachsen von Kindern beeinflussen können, wird im Folgenden exemplarisch anhand der Orientierungsmuster „Verantwortung“ und „Sicherheit“ skizziert. Weitere identifizierte Orientierungsmuster sind „Zusammenhalt“, „Geradlinigkeit“, „Unabhängigkeit“ und „Familienzusammenführung“.
Bei Eltern, die Familienerziehung vor dem Hintergrund des Orientierungsmusters „Verantwortung“ gestalten, dokumentieren sich u.a. die Abwesenheit großer erweitert-familiärer Netzwerke in Deutschland, wie besonders Großeltern, Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen, welche bei der Erziehung und Betreuung der Kinder unterstützen könnten, sowie (familien-)biografische Erfahrungen von Flucht als handlungsleitende Bezugspunkte (Korn/Westphal 2024). Eltern nehmen eine hohe Alleinverantwortung für die Erziehung ihrer Kinder in Deutschland wahr, was anhand der Aussage eines Vaters „I have to be everyone for the kids“ (Z. 431-432, Fuadi und Nasteh) besonders deutlich wird. Diese steht in Diskrepanz zur Bedeutung erweitert-familiärer Gemeinschaft in Somalia, wie sie manche Eltern, die als Kind bei Verwandten aufwuchsen, selbst erfahren haben. In Somalia hast „du [die] ganze Familie in deiner Nähe“ (Z. 104), aber in Deutschland „musst [du] viel Zeit in die Kinder investieren“ (Z. 103, Fuadi und Nasteh). Eltern, die im Rahmen des Orientierungsmusters „Verantwortung“ handeln, deuten die Bildung ihrer Kinder als Zukunftsinvestition für die es u.a. erforderlich ist, vorausschauend sog. „Bildungspartnerschaften“ mit den entsprechenden Bildungsinstitutionen einzugehen. So initiiert ein Fallvater proaktiv regelmäßige (Entwicklungs-)Gespräche mit pädagogischen Fachkräften. „So, I used to call them every three months to talk to them how it is going with my kid, how he is adapting” (Z. 883-884, Fuadi und Nasteh). In der Beziehung zur institutionellen Betreuung zeigen sich jedoch auch Ambivalenzen, Brüche und Konflikte, die dazu führen, dass Eltern sich bei der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder weder auf erweiterte Familie noch vollkommen auf institutionelle Angebote verlassen können. Kritisch hervorgehoben werden im Rahmen dieses Orientierungsmusters beispielsweise eine als unzureichend empfundene Sprachförderung sowie vereinzelt als wenig engagiert wahrgenommene Fachkräfte. Kindertageseinrichtungen werden aber zu keinem Zeitpunkt grundsätzlich infrage gestellt. Dennoch veranlasst es manche Familien dazu, ihren Kindern transnationale Erfahrungen durch längere Familienbesuche in Ostafrika zu ermöglichen. Im Rahmen der hohen elterlichen Verantwortung wird Transnationalität damit zu einem Bildungsziel (z.B. im Hinblick auf Mehrsprachigkeit) und im Sinne des „transnational doing family“ zu einem sinnstiftenden Moment der Herstellung familialer Zugehörigkeit über Grenzen hinweg. Dieses Wir-Gefühl hat auch über den Besuch hinaus, zum Beispiel in Form regelmäßiger Videotelefonate mit Großmüttern, Bestand. Die Sozialisation der Kinder vollzieht sich somit unter großer Verantwortung der Eltern sowohl in hiesigen Bildungs- und Betreuungsinstitutionen als auch in transnationalen Kontexten.
Das teilweise kontrastierende Orientierungsmuster „Sicherheit“ zeigt sich besonders bei Familien mit relativ kurzer Aufenthaltsdauer in Deutschland und in prekären Wohnsituationen wie bspw. Gemeinschaftsunterkünften. Bei diesen Familien lässt sich eine Orientierung rekonstruieren, die die Sicherheit und das Wohlbefinden der Kinder sowie die grundsätzliche Sicherung des (Über-)Lebens zentral setzen. Familien dieses Orientierungsmusters zeigen sich ebenfalls äußerst verantwortungsvoll für das Aufwachsen ihrer Kinder, sind in ihren habituellen Handlungen und Deutungen jedoch verstärkt auf Sicherheit bedacht. Für eine Familie, die dieses Orientierungsmuster zeigt, hat das Überleben, die Gesundheit und Förderung eines ihrer Kinder mit Behinderung höchste Priorität. An die Eltern als Norm herangetragene Angebote wie institutionelle Kindertagesbetreuung nehmen die Eltern vertrauensvoll an („Wir wussten nichts über den Kindergarten, aber sie sagten uns, dass er hingehen sollte.“, Z. 1150, Abdinasir und Halima).[2] Sie streben für ihre Kinder nach der Ermöglichung sozialer Teilhabe sowie Zugehörigkeit zur Kindergruppe („Es ist gut, wenn das Kind an einem sicheren Ort ist, und wenn das Kind mit der Gemeinschaft interagiert“, Z. 1167-1168, Abdinasir und Halima). Eine regelmäßige Kommunikation mit pädagogischen Institutionen, wie beim Orientierungsmuster „Verantwortung“ deutlich wird, zeigt sich in diesen Familien (noch) nicht. Die Kommunikation zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften beschränkt sich beidseitig auf ein Minimum. Zudem zeigt sich bei den Eltern Unklarheit über Aufgaben und Möglichkeiten spezialisierter (Förder-)Angebote wie Frühförderung, die von institutioneller Seite als notwendig erachtet, aber mit der Familie offenbar nicht entsprechend kommuniziert werden („Sie haben mit ihm gespielt, ihm ein bisschen was gezeigt und dann sind sie auch wieder gefahren“, Z. 877-878, Abdinasir und Halima). Im Sinne des Orientierungsmusters wird diese Förderung zwar ins familiäre Umfeld gelassen, aber das zunächst hohe Initialvertrauen in Institutionen erfährt Irritationen und Risse. Konkrete elterliche Vorstellungen über das, was Kinder und Familie tatsächlich benötigen, stehen in Diskrepanz zum Handeln pädagogischer Einrichtungen. Für das Orientierungsmuster „Sicherheit“ kann eine starke Verankerung elterlichen Handelns in an sie herangetragene sozialpädagogische Normen und institutionelle Strukturen rekonstruiert werden. Diese wirken machtvoll auf den Alltag der Familien ein und werden zwar grundsätzlich positiv bewertet, aber erscheinen insgesamt intransparent. Kommunikationsbarrieren begrenzen die Zusammenarbeit mit den Institutionen.
Während sich für das Orientierungsmuster „Verantwortung“ eine enge Kooperation mit lokalen pädagogischen Institutionen rekonstruieren lässt und Kindern gleichzeitig gezielt transnationale (Bildungs-)Erfahrungen ermöglicht werden, geht es beim Orientierungsmuster „Sicherheit“ grundsätzlicher um die Sicherstellung von Stabilität und sozialer Teilhabe der Kinder an einer Gemeinschaft sowie Gesundheit und Entwicklung. Weiterhin stehen einige Eltern dieses Orientierungsmusters vor der Herausforderung das (Über-)Leben in Ostafrika zurückgelassener Kinder oder Partner:innen zu sichern.
Was kann das für die Praxis bedeuten?
Anhand der skizzierten Orientierungsmuster zeigt sich, wie vielschichtig, komplex und divers familiale Lebenswelten und Familienkulturen im Kontext von Flucht und Asyl sind. Für die pädagogische Praxis hat dies auch über fluchtspezifische Aspekte hinaus eine hohe Relevanz. Nimmt man den Anspruch ernst, dass Kinder sich mit ihren Lebenswelten in pädagogischen Einrichtungen wiederfinden sollen, kann damit für Fachkräfte zunächst die Frage verbunden sein: Wie sehen diese denn konkret aus? Transnationale Lebenswelten von Kindern und ihren Familien finden in Kitas und Grundschulen bislang kaum eine Berücksichtigung, die über stereotypisierende herkunftslandspezifische Zuschreibungen hinausgehen würde (Korn 2023). Dabei lässt sich eine deutliche Gleichzeitigkeit und Überlagerung lokaler und transnationaler Lebenswelten von Kindern und ihren Familien feststellen (Westphal et al. 2025), wie an den beiden vorgestellten Orientierungsmustern deutlich wurde. Die Berücksichtigung transnationaler Lebenswelten und deren Bedeutung für Bildungsprozesse aller Kinder in einer global vernetzten Welt, sollte daher als pädagogische Aufgabe verstanden werden. Fragen digitaler Medien(erziehung) in transnationalen Räumen (Korn/Westphal 2025) sind dabei weiterhin zu berücksichtigen. Außerdem zeigt sich die enorme Bedeutung der konstruktiven und transparenten Zusammenarbeit mit den Eltern oder Bezugspersonen in lokalen pädagogischen Institutionen. Mehrsprachigkeit kann hierbei eine Dimension darstellen, die es zu berücksichtigen gilt, aber darf kein Hindernis sein. Eine diskriminierungskritische Perspektive nimmt den Eigensinn, die Deutungen und Familienkulturen aller Familien in (früh)pädagogischen Institutionen sowie die den Institutionen innewohnenden Macht- und Ungleichheitsverhältnisse ernst. Fluchtspezifische Aspekte können hierbei für das Aufwachsen von Kindern ebenso eine Rolle spielen wie sozioökonomische Verhältnisse, Rassismus, Behinderungen/ Beeinträchtigungen, Mehrsprachigkeit oder transnationale Lebenswelten.
Literaturverweise
Aden, Samia/Westphal, Manuela (2021): Undoing und Not Doing Family in der Fluchtmigration. Migration und Soziale Arbeit, 43 (4). 321–228. https://doi.org/10.3262/MIG2104321
Bohnsack, Ralf (2018): Orientierungsmuster. In: Bohnsack, Ralf/Geimer, Alexaner/Meuser, Michael (Hrsg.): Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung. 4. Aufl. Opladen/Toronto: Barbara Budrich, S. 183-184. https://doi.org/10.36198/9783838587479
Bohnsack, Ralf (2021): Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative Methoden. 10. Auflage. Opladen: Barbara Budrich. https://doi.org/10.36198/9783838587851
Buser, Fränzi (2024): “Sometimes, she’s a bit an angry girl”: Fremd- und Selbstpositionierungen von Kindern in Unterkünften für Geflüchtete in der Schweiz. In: Röhner, Charlotte/Schwittek, Jessica/Potsi, Antoanneta (Hrsg.): Transmigration und Place-making junger Geflüchteter. Opladen/Berlin/Toronto: Barbara Budrich, S. 127–143.
Hammond, Laura (2014): History, overview, trends and issues in major Somali refugee displacements in the near region. Research Paper No. 268. UNHCR.
Jurczyk, Karin unter Mitarbeit von Thomas Meysen (2020): UnDoing Family: Zentrale konzeptionelle Annahmen, Feinjustierungen und Erweiterungen. In: Jurczyk, Karin (Hrsg.): Doing and Undoing Family: Konzeptionelle und empirische Entwicklungen (S. 26–55). Weinheim: Beltz Juventa.
Korn, Franziska (2023): Transnationalität in institutionalisierten Bildungskontexten. In: Alisch, Monika/Westphal, Manuela (Hrsg.): Soziale Nachhaltigkeit in der (Post)Migrationsgesellschaft. Opladen/Berlin/Toronto: Barbara Budrich. S. 199–213.
Korn, Franziska/Westphal, Manuela (2024): „I Have to Be Everyone for the Kids“. Familiendynamiken und elterliche Verantwortungen im Kontext von Flucht und Asyl. In: Frühe Bildung 13, H. 4, S. 180–186. https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000682
Korn, Franziska/Westphal, Manuela (2025): Digitale Praktiken im Doing Family von geflüchteten Kindern und Eltern. In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 20, H. 2, S. 153–166.
Korntheuer, Annette/ Korri, Rayan (2021): Familienbildung im Kontext von Fluchtmigration. In: Migration und Soziale Arbeit, 43 (4): 329–339. https://doi.org/10.3262/MIG2104329
Neumann, Sascha (2019): Ethnographie und Dokumentarische Methode. In: Dörner, Olaf/Loos, Peter/ Schäffer, Burkhard/Schondelmayer, Ann-Christin (Hrsg.): Dokumentarische Methode: Triangulation und blinde Flecken. Opladen/Berlin/Toronto: Barbara Budrich, S. 52–67. https://doi.org/10.2307/j.ctvkjb282.6
Sandermann, Philipp/Friedrichs-Liesenkötter, Henrike/Henkel, Anna/Husen, Onno/Kakar, Hila/Münch, Sybille/Schwenker, Vanessa/Siede, Anna/Wenzel, Laura/Winkel, Marek (2023): Integration durch Vertrauen? Hauptergebnisse einer explorativen Mixed Methods-Studie zum Vertrauensaufbau geflüchteter Eltern gegenüber frühpädagogischen Angeboten. In: Migration und Soziale Arbeit 45, H. 2, S. 166–172. https://doi.org/10.3262/MIG2302166
Westphal, Manuela/Motzek-Öz, Sina/Aden, Samia (2019): Transnational Doing Family im Kontext von Fluchtmigration. Konturen eines Forschungsansatzes. In: Behrensen, Birgit/Westphal, Manuela (Hrsg.): Fluchtmigrationsforschung im Aufbruch. Wiesbaden: Springer VS, S. 251–272.
Westphal, Manuela/Korn, Franziska (2023): Transnationale family-relations-networks. Relevanz und Ko-Konstruktion von Familienbeziehungen in Forschung und Praxis Sozialer Arbeit. In: Migration und Soziale Arbeit 45, H. 3, S. 267–274. https://doi.org/10.3262/MIG2303267
Westphal, Manuela/Korn, Franziska/Li-Gottwald, Jiayin/Aden, Samia (2025): Parenting in Refugee Families: Established-Outsider Dynamics from a Transnational Perspective. In: Families, Relationships and Societies 14, H. 1, S. 109–124. https://doi.org/10.1332/20467435Y2024D000000046
Wihstutz, Anne (2019): Zwischen Sandkasten und Abschiebung. Zum Alltag junger Kinder in Unterkünften für Geflüchtete. Opladen: Barbara Budrich.
[1] Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und unter Leitung von Prof. Dr. Manuela Westphal an der Universität Kassel durchgeführt.
[2] Das Interview wurde zwischen Deutsch und Somali gedolmetscht. Das Transkript wurde später übersetzt und gegengeprüft.